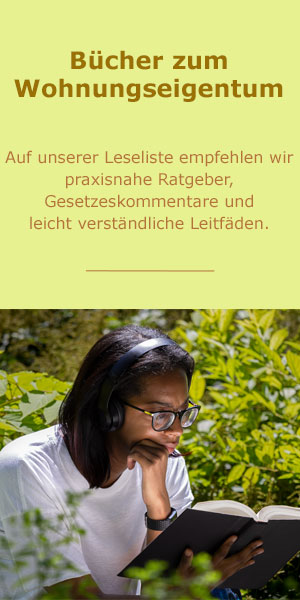Die Ausübung einer Arztpraxis in einer Eigentumswohnung stellt keinen Nachteil dar, der über das bei einem geordneten Zusammenleben unvermeidliche Maß hinausgeht. Der Charakter eines Hauses als reines Wohnhaus geht durch die Einrichtung einer Arztpraxis nicht verloren, weil es allgemein üblich und weit verbreitet ist, eine ärztliche Praxis in einer Wohnung auszuüben. Dies gilt selbst für ein Wohnhaus, das höchsten Ansprüchen gerecht wird (AG Hamburg, Beschl. vom 09.04.1956, 102 II W 1/56; insoweit auch BayObLG, Beschl. vom 05.01.1984, 2 Z 23/83, dort zur zulässigen Ausübung einer Krankengymnastikpraxis).
Auch wenn die Berufsausübung an die Zustimmung des Verwalters gebunden ist und nur aus wichtigem Grund versagt werden darf, ist zumindest bei Betrieb einer Zahnarztpraxis in einer Erdgeschoßwohnung sowie bei der Ausübung einer Frauenarztpraxis im zweiten Geschoß eines Hochhauses keine Beeinträchtigung zu erwarten, die ein Verbot der Praxisausübung aus wichtigem Grund rechtfertigen würde (BayObLG, Beschl. vom 04.01.1973, 2 Z 73/72; OLG Karlsruhe, Beschl. vom 15.01.1976, 11 W 93/75; KG Berlin, Beschl. vom 09.07.1986, 24 W 2741/86; anders allerdings für den Fall, dass der Zugang zur Arztpraxis über einen Laubengang führt, so dass eine Einblick in andere Anliegerwohnungen gegeben ist, Beschl. vom 10.05.1979, 2 Z 31/78).
Eine Ausnahme könnte auch für den Fall gelten, dass es sich um die Ausübung einer ärztlichen Praxis für ansteckende oder gefährliche Krankheiten handelt (vgl. hierzu Bärmann, a.a.O., § 13 Rz. 58).
Soweit im übrigen eine Zweckbestimmung in Form differenzierter Nutzungsarten gewissermaßen Konkurrenzauschlußregelungen trifft, kann die Nutzung eines als "Büro" bezeichneten Teileigentums als Arztpraxis unzulässig sein (insoweit für den konkreten Fall zutreffend OLG Stuttgart, Beschl. vom 04.11.1986, 8 W 357/86).
Übrigens, eine ganz andere Auffassung vertrat das BayObLG im Jahr 2000. Hier wurde der Betrieb einer schon langjährig bestehenden Arztpraxis in einer Wohnungseigentumsanlage untersagt.
Der Sachverhalt: Die Teilungserklärung einer großen Wohnanlage sah es nicht vor, dass sich dort ein Arzt niederlassen darf. Trotzdem entschied sich einer der Eigentümer zu diesem Schritt, ohne jemanden zu fragen. Als die Praxis bereits seit einigen Jahren betrieben wurde, gab es plötzlich Beschwerden von Seiten der anderen Eigentümer. Der Arzt müsse wieder verschwinden, entschieden die Kläger, denn seine Anwesenheit sei von Anfang an nicht rechtens gewesen. Der Betroffene berief sich auf eine Art Gewohnheitsrecht, weil seine Praxis jahrelang geduldet worden sei.
Das Urteil: Das Gericht schlug sich auf die Seite der protestierenden Mehrheit der Wohnungseigentümer. Es sei in diesem Fall rechtlich unerheblich, dass erst nach langer Zeit Klage erhoben wurde. Viel entscheidender sei das ursprüngliche Fehlverhalten des Eigentümers, seine Wohnung überhaupt für diesen Zweck freizugeben. Eine Arztpraxis mit erheblichem Patientenverkehr störe in der Wohnanlage eindeutig mehr als eine normal genutzte Wohnung (BayObLG, Aktenzeichen 2 Z BR 50/00).