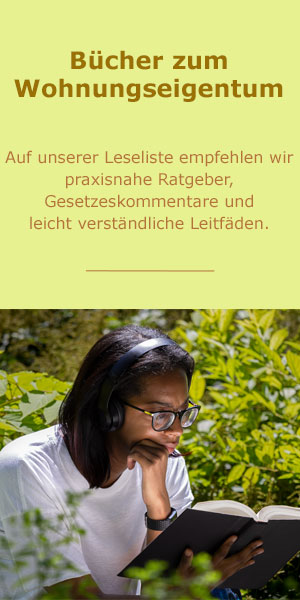Beantragen Senioren in Mehrfamilienhäusern den Einbau eines Treppenliftes, zeigen manche Mitgeigentümer wenig Verständnis für die älteren Mitbewohner, ganz anders die Gerichte!
Eine 95-jährige Hamburgerin litt unter schwerer Arthrose, die Treppe zu ihrer Wohnung im zweiten Stock wurde zunehmend zur Qual. Deshalb beantragte sie auf eigene Kosten einen Treppenlift einbauen zu dürfen. Das Bauamt und die Mehrheit der Bewohner stimmten zu. Doch eine Eigentümerin fürchtete um das Erscheinungsbild des "repräsentativen Treppenhauses" und zog vor Gericht. Ohne Erfolg. Laut Verfassung dürfen Behinderte nicht benachteiligt werden, so die Richter. Die Erleichterung für die Seniorin sei wichtiger als die "geringfügige" Veränderung des Eingangsbereichs (LG Hamburg, 318 T 70/99).
Auch ein Mann aus Tübingen legte sein Veto ein, nachdem ihn die Eigentümer der über seinem Geschäft liegenden Wohnungen überstimmt und den Einbau eines Treppenliftes mehrheitlich beschlossen hatten. Sein Argument: Da der Lift exklusiv für eine ältere Mieterin bestimmt sei, erhalte die ein Sondernutzungsrecht. Ein solches Recht könne aber nur einstimmig gewährt werden. Die Richter sahen auch das anders. Von einem Sondernutzungsrecht könne keine Rede sein, selbst wenn der Lift faktisch nur von einer Person genutzt werde (LG Erfurt, 7 T 575/01).
Schiffbruch erlitten auch Mitglieder einer Münchner Eigentümergemeinschaft, die wegen des Lifts ihre Sicherheit gefährdet sahen, weil der Durchgang auf der Treppe durch die Vorrichtung weniger als einen Meter schmal wurde. Das Argument gelte nur, wenn der Lift in Betrieb sei, hielten die Bayrischen Richter dagegen. Zudem sei ein auf normalem Weg hinabsteigender Gehbehinderter ein viel größeres Hindernis als ein Treppenlift (OLG München, 32 Wx 51705).
Auch eine betagte Krefelderin erhielt vom zuständigen Amtsgericht grünes Licht. Diese hatte sich vor geraumen Jahren in der ersten Etage einer Wohnungseigentumsanlage ihren Altersruhesitz geschaffen. Im Laufe der Jahre war sie jedoch nicht mehr in Lage, die Treppen zu steigen und konnte deshalb ihre Wohnung fast nicht mehr verlassen. Auf eigene Kosten wollte auch sie sich deshalb im Treppenhaus einen Treppenlift installieren lassen. Bis auf ein Eigentümerpaar stimmten alle zu. Die sturen Eigentümer argumentierten, daß die Seniorin doch ausziehen könne, zudem stelle der Treppenlift eine Gefahr für sie dar. Die Krefelder Richter stellten klar, dass die Eigentümer die Beeinträchtigung zu dulden hätten. Weiter könne die betagte Dame nicht darauf verwiesen werden, ihre Wohnung zu verkaufen und in eine Wohnung im Erdgeschoß zu ziehen. Die Verweigerung, einem behinderten Wohnungseigentümer den Einbau eines Liftes zu gestatten, würde eindeutig eine Diskriminierung darstellen. Auch der Behinderte muß, wie der Gesunde, die Möglichkeit haben, seine Wohnung zu erreichen (AG Krefeld 38 UR II 88/98).
Grundsätzliche Überlegungen des OLG München zum Einbau eines Treppenliftes in einer Wohnungseigentumsanlage
Der Einbau eines Treppenlifts ist eine bauliche Veränderung im Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes. Es handelt sich weder um eine Instandhaltung durch Erhaltung des ursprünglich ordnungsgemäßen Zustands, noch um eine modernisierende Instandsetzung durch Ersatz einer veralteten Anlage.
Deshalb bedarf der Einbau des Treppenlifts im gemeinsamen Treppenhaus der Zustimmung aller anderen Miteigentümer. Grundsäztlich besteht kein Anspruch auf Zustimmung zu dieser baulichen Veränderung. Würden allerdings die übrigen Wohnungseigentümer durch die bauliche Veränderung nicht über das unvermeidliche Maß hinaus beeinträchtigt, bestehe gegen sie ein Anspruch auf Duldung der baulichen Maßnahme.
Es muss also eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Das Interesse des Gehbehinderten auf leichten und gefährdungsfreien Zugang zu seiner Wohnung bemesse sich vor allem nach dem Grad und Umfang seiner Behinderung. Je stärker die Beeinträchtigung sei, desto stärkeres Gewicht komme dem Verbot der Benachteiligung Behinderter zu. Das Interesse der anderen Wohnungseigentümer (z.B. Vermeiden von massiven baulichen Eingriffen, räumliche Enge und teilweise Unbenutzbarkeit des Treppenhauses) müsse dann dahinter zurückstehen (OLG München, 34 Wx 66/07).
Besteht Interesse an der Montage eines Treppenlifts, gibt es bei vielen Anbietern die Möglichkeit einen unverbindlichen Beratungstermin in Anspruch zu nehmen. Bei diesem werden die Gegebenheiten vor Ort in Augenschein genommen und ein passendes Angebot erstellt. Unter Umständen ist es sinnvoll, die anderen Wohnungseigentümer daran teilhaben zu lassen, sodass mögliche Sorgen oder Zweifel im Termin ausgeräumt werden können. Die Finanzierung der Treppenlifte liegt in der Regel bei denjenigen Personen, die diese auch nutzen möchten, wie die vorangegangenen Urteile zeigen.
Weitere Informationen zur zur Abgrenzung der Begriffe Bauliche Veränderung - Modernisierung - modernisierende Instandsetzung finden sie hier.